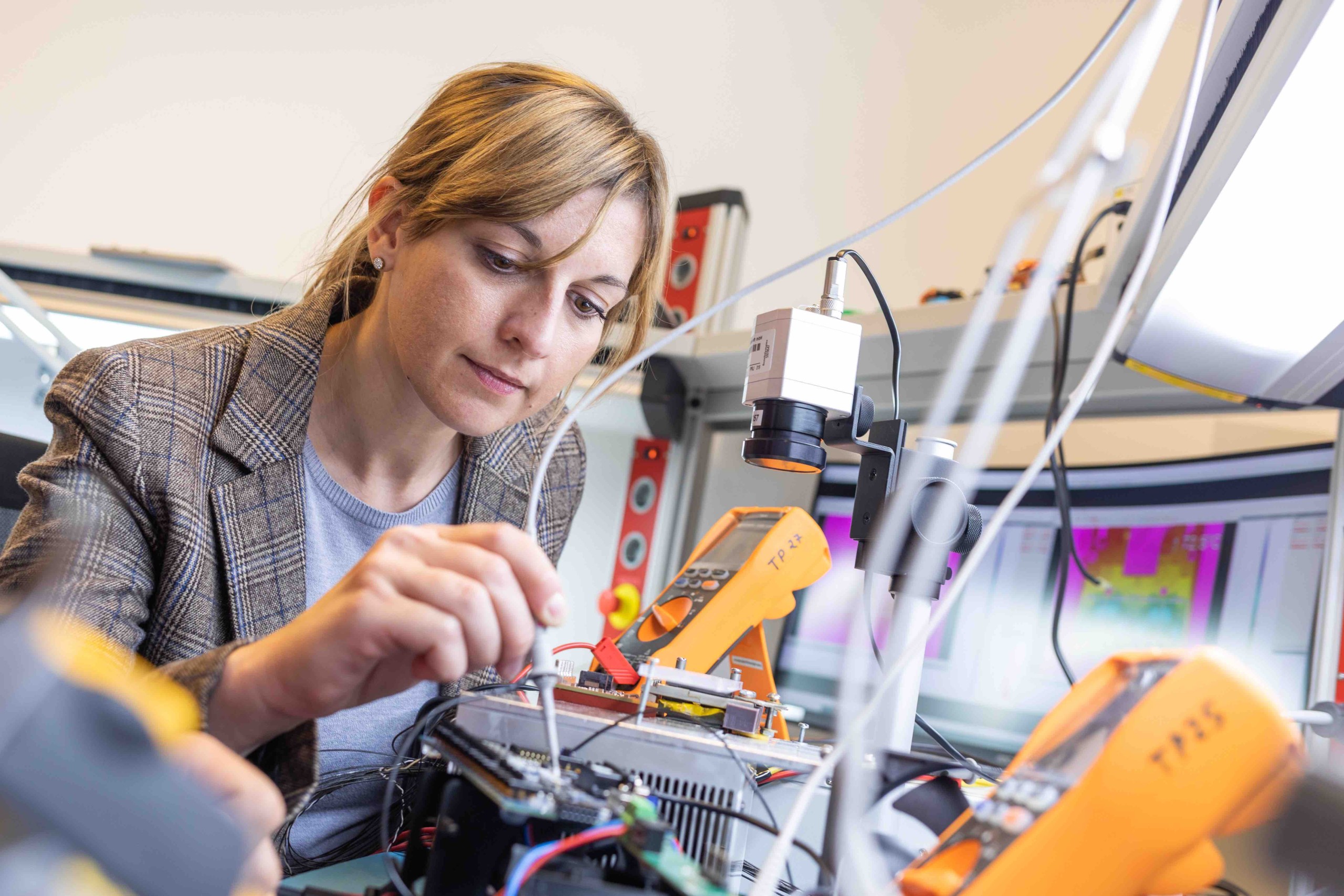Die Use Cases im Fokus
Wie bereits im Arctic Log #1 angekündigt, widmet sich das JOANNEUM Arctic Expedition Team (AET) in der aktuellen Vorbereitungsphase nicht nur der logistischen Planung der bevorstehenden Expedition, sondern insbesondere auch der inhaltlichen Ausarbeitung der einzelnen Forschungsprojekte – den Use Cases. Diese bilden das Herzstück der Expedition und werden von den Studierenden selbst entwickelt und in der Arktis umgesetzt. In dieser Arctic Log Ausgabe stellen wir die Use Cases nun ausführlicher vor.
Die inhaltliche Vielfalt der Projekte spiegelt sich in den unterschiedlichen Fachrichtungen der teilnehmenden Studierenden wider. Was sie jedoch alle eint ist das Ziel, einen relevanten wissenschaftlichen Beitrag zur Arktisforschung zu leisten und dabei neuartige Technologien und interdisziplinäre Ansätze in extremen Umweltbedingungen zu testen. Dabei steht immer eines im Fokus: das umweltschonende und verantwortungsbewusste Sammeln wissenschaftlicher Daten für die Forschung.
Use Case #1: Die Nutzung von Drohnen im Rahmen der Arktisforschung
Drohnen bilden einen wichtigen Bestandteil für mehrere Vorhaben der Expedition und werden gleich in mehreren Projekten eingesetzt. Grönland ist nicht nur für seine atemberaubenden Gletscherlandschaften bekannt, sondern auch für sein sensibles Ökosystem und geschützte Tierarten wie den Eisbären. Ziel des ersten Projekts ist es, die technischen und logistischen Grundlagen für einen sicheren und umweltschonenden Drohneneinsatz in der Arktis zu schaffen. Während einer zehntägigen Expedition liegt der Fokus auf der Planung, dem Transport und der Durchführung von Drohnenflügen unter extremen Bedingungen: Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt, begrenzte Stromversorgung, wechselhaftes Wetter und strenge Luftfahrtregeln. Gleichzeitig muss der Schutz der Tierwelt – insbesondere störungsempfindlicher Arten – jederzeit gewährleistet sein.
Ein weiteres Projekt, das auf den Einsatz von Dronen in arktischen Landschaften zurückgreift, widmet sich der automatisierte Erkennung von Schmelzwasserkanälen auf Gletschern. Diese oberflächlichen Wasserläufe liefern wertvolle Informationen über das Abschmelzen des Eises und somit über den Klimawandel. Mittels Machine Learning wird ein Computermodell trainiert, das diese Kanäle auf Basis von Drohnen- und Satellitenbildern erkennen kann. Um die Genauigkeit des Modells zu überprüfen, werden während der Expedition neue Bilddaten vom Mittivakkat-Gletscher aufgenommen und durch Geländemessungen ergänzt.
Das dritte Projekt dieses Use Cases ist die Verwendung von Drohnen als unterstützendes Tool bei der umweltschonenden Entnahme diverser Proben für weitere Forschungszwecke. Hier kommen speziell ausgerüstete Drohnen zum Einsatz: Sie sind mit Greifarmen, Probenlöffeln und Absenkvorrichtungen ausgestattet, um zum Beispiel gezielt Bodenproben in schwer zugänglichem Gelände zu entnehmen – effizient, sicher und mit minimalem Eingriff in die Umwelt. Vor Ort können dann direkt erste Analysen vorgenommen werden.